Ich schreibe an diesem Roman – Immer noch wach – und ein signifikanter Teil spielt in einem stationärem Hospiz. Meine Hospizerfahrung beschränkte sich bis vor kurzem auf das Wissen über ihre Existenz. Da werden kranke Menschen beim Sterben begleitet. Das reicht aber nicht, um darüber zu schreiben. Also habe ich mir ein paar Artikel und die ein und andere Wiki-Seite durchgelesen, habe mir Dokumentationen angesehen und mit Leuten geredet, die im Hospiz arbeiten. Und das war ein eklatanter Unterschied.
Während die Erzählungen sehr warm und wohlwollend, sehr menschlich und nah waren, hatte jede Dokumentation einen beklemmenden, distanzierten und betroffenen Beigeschmack. Jede Dokumentation beinhaltet den Satz ‚man darf dort auch lachen‘ und jedes Mal fühlt es sich gesagt, aber nicht gemeint an. Also es selbst erleben, ein paar Tage mitlaufen und alle Fragen stellen.
Ich war mir nicht sicher, wie ein Hospiz auf so eine Anfrage reagieren würde und hätte es verstanden, wenn ich aus Gründen des Respekts und der Pietät nicht hätte kommen dürfen. Also schrieb ich eine lange Nachricht, in der ich sagte, dass es mir um die akkurates und warmes Bild eines Alltags im Hospiz ging. Dass ich über den Weg des Romanes die Relevanz, die Arbeitsweise und die Wichtigkeit von Hospizen aufzeigen und Menschen nahebringen wollte.
Der Nachricht folgte ein Telefonat und dann war klar, dass ich eine Woche mitarbeiten würde. Wenn ich schon da war, dann nicht nur als Zuschauer, sondern als Praktikant, der auch Aufgaben übernimmt. Und auch nur als Ausnahme für lediglich eine Woche, normalerweise geht nichts unter vier Wochen. Vor dieser Woche sollte ich zuerst einmal vorbeikommen, mir alles ansehen und dann entscheiden, ob ich die Woche machen wollte.
Kurz vor dem ersten Besuch hatte ich extremen Respekt und Zweifel, ob ich wirklich eine Woche lang dort zubringen würde. Dort zubringen könnte. Ich kann kein Blut sehen, bin viel zu emphatisch und fantasievoll, was Schmerzen angeht. Beschreibt mir jemand seine, spüre ich sie selbst. Ich muss auch bei Büchern, Filmen und Serien manchmal pausieren, wenn es mir zu explizit wird. Wollte ich wirklich eine Woche lang Menschen beim Sterben begleiten?
Ich komme im Hospiz an und sehe die brennende Kerze, das Signal, dass kürzlich jemand verstorben ist. Dann muss ich warten, weil die Pflegerin, die mich herumführen sollte, noch bei der Trauerfeier ist. Das fängt an, wie befürchtet.
Ich warte also, den Kopf gesenkt, die Hände im Schoß und betrachtete die Kerze und den Namen der Verstorbenen in einem Buch, welches davor lag. Kinderhände hatten bunte Schmetterlinge darüber gemalt und einen steinernen Engel dazugelegt.
Und dann kommt die Pflegerin, die mich begrüßt hat, fragt mich nach meinen Computerkenntnissen und ob ich helfen könne. Kurz darauf stehe ich im Zimmer eines Gastes – es gibt im Hospiz keine Patienten, es gibt nur Gäste – und half, den Bundesliga-Livestream zu aktivieren.
Danach esse ich Kuchen und lache über einen makaberen Witz, beobachte, wie ein Gast dick eingepackt mit seinem Rollstuhl nach draußen rollt, um eine Rauchen zu gehen. Um seinen Hals hängt die Schmerzmittelpumpe, die ihm beständig ein Morphin eingibt. Und wenn er doch noch Schmerzen hat, kann er sich einen Bolus geben.
Ich werde durch das Gebäude geführt und erfahre in diesen ersten Stunden schon so viel über das Leben und Arbeiten im Hospiz. Als ich nach Hause gehe, weiß ich, dass ich für diese Woche wiederkommen werde. Weil, natürlich sterben dort Menschen und es ist ein sehr sehr trauriger Ort. Aber eben nicht nur. Insgesamt fühlt es sich nach ein paar Stunden eher nach einem Ferienlager an. Für kranke Menschen zwar, die nie wieder nach Hause gehen, aber dennoch ein schöner Ort, in dem viel erlaubt ist.
Also arbeite ich eine Woche mit, gebe Essen ein, pflege und sitze stundenlang bei Menschen. Halte ihre Hand und rede mit ihnen. Ich war mir ziemlich unsicher, wie die Menschen dort auf mich reagieren würden, ob sie offen mit mir reden würden. Tatsächlich wurde ich extrem herzlich empfangen und jeder erzählte mir freigiebig. Von den PflegerInnen über die Gäste, bis hin zur Pfarrerin und der Ärztin, ich konnte alle Fragen stellen, die ich stellen wollte und erfuhr darüber hinaus noch viel mehr.
In meiner Zeit dort sterben zwei Menschen und fast jedes Schicksal dort macht mir klar, dass das Leben keine Geschichte ist, die zwangsläufig gut endet. Viel zu oft, können Menschen sich nicht von jenen verabschieden, von denen sie sich unbedingt verabschieden wollen. Schaffen es nicht nochmal, diesen Urlaub zu machen oder sich mit jenem Menschen zusammenzusetzen, um Dinge zu klären, die jahrzehntelang nicht geklärt wurden.
Diese Wahrheit – „Tue Dinge, die du tun willst, bevor es zu spät ist“ wird uns regelmäßig, in allen möglichen Filmen, Serien, Büchern, Liedern und Anekdoten eingetrichtert, sie ist so banal, wie kompliziert. Sie ist nichts neues. Sie aber auf diese Art zu erleben, ist viel eindrücklicher, als alles bisherige.
Ich mache alles mit. Katheter setzen, blutige Verbände wechseln, Abschiedsfeiern beiwohnen. Alles mit einer absurden Distanz, auf der ich meine Seele halte, um diese Dinge erleben zu können, sie aufnehmen zu können. Sobald ich nach Hause komme, erzähle ich meiner Freundin davon, lasse alles an mich heran und heule mich in den Schlaf. Um am nächsten Tag wieder dort zu sein.
Für mich am Eindrücklichsten, am Emotionalsten ist die Verbundenheit zweier Menschen. Eines Paares, das mehr als vierzig Jahre lang zusammen war und ein Mensch nun seinen Partner im Arm hat, während er wimmernd, verwirrt und traumatisiert im Bett liegt und so würdevoll wie möglich von uns intim gepflegt wird. Unten wir, mit Gummihandschuhen und Waschlappen und Inkontinenzhosen. Oben sie, mit Küsschen und Kosenamen und intimer Nähe. Skurriler konnte es nicht sein. Niemals habe ich bedingungsloser Liebe erlebt. Die Erinnerung daran drückt mir jedes Mal Tränen in die Augen.
Nach einer Woche bin ich fertig. Ich umarme das Personal und weiß, in irgendeiner Form werde ich wieder kommen. Ich bin sehr froh, diese Woche dort verbracht zu haben, an diesem herzlichen, warmen Ort, in dem extrem viel Dankbarkeit und Menschlichkeit vorhanden ist.
Aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist, weil dort extreme Emotionen in jede Richtung zum Vorschein kommen. Ich kann mich nicht emphatisch und menschlich um jemanden kümmern, ohne ihn auch an mich heranzulassen. Es ist ein destilliertes, in kürzester Zeit jemanden kennen und mögen lernen, um ihn dann zu verlieren. Nun ist meine Zeit dort ein paar Tage her und ich knabbere immer noch an dem, was ich erlebt habe. Meine Hochachtung jedem, der diese Arbeit macht.
Jeder sollte ein Hospiz zumindest mal für ein paar Stunden besuchen. Es kalibriert das Leben. Setzt Prioritäten anders. Ich freue mich mehr und ärgere mich weniger. Ich verbringe Zeit mit Menschen bewusster und ich sage, was ich sagen will, auch wenn ich mich dabei manchmal dumm fühle. Dafür bin ich dankbar. Ich hoffe, das hält eine Weile an.
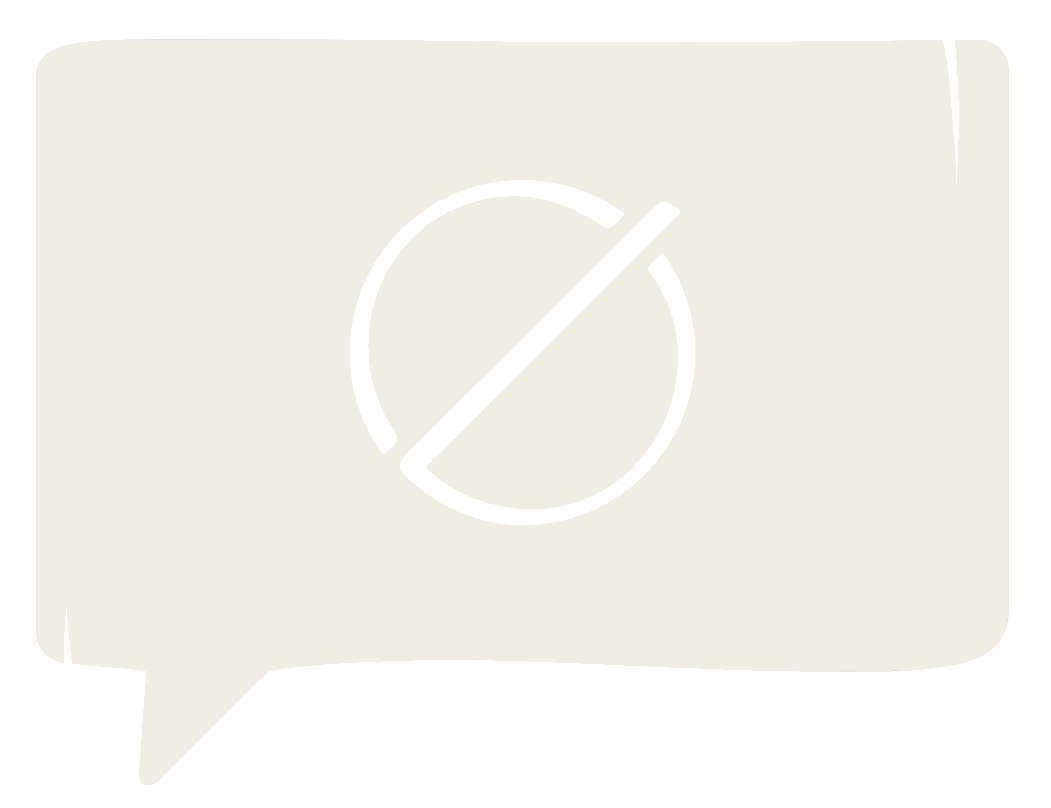
Schreibe einen Kommentar